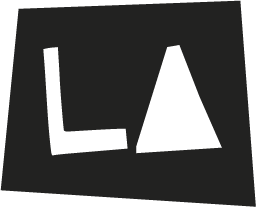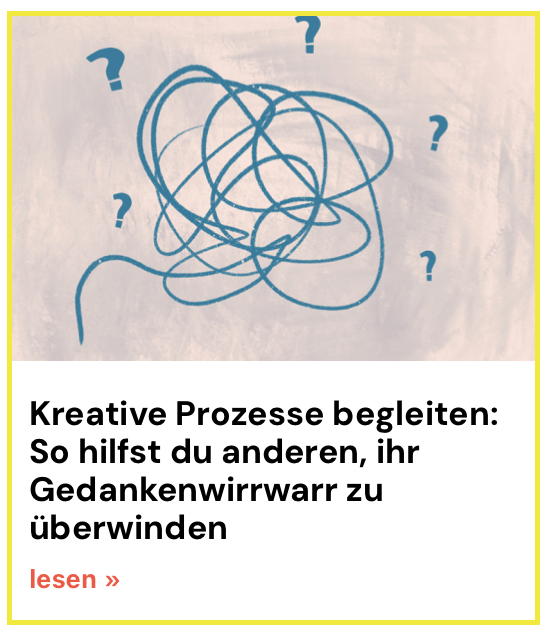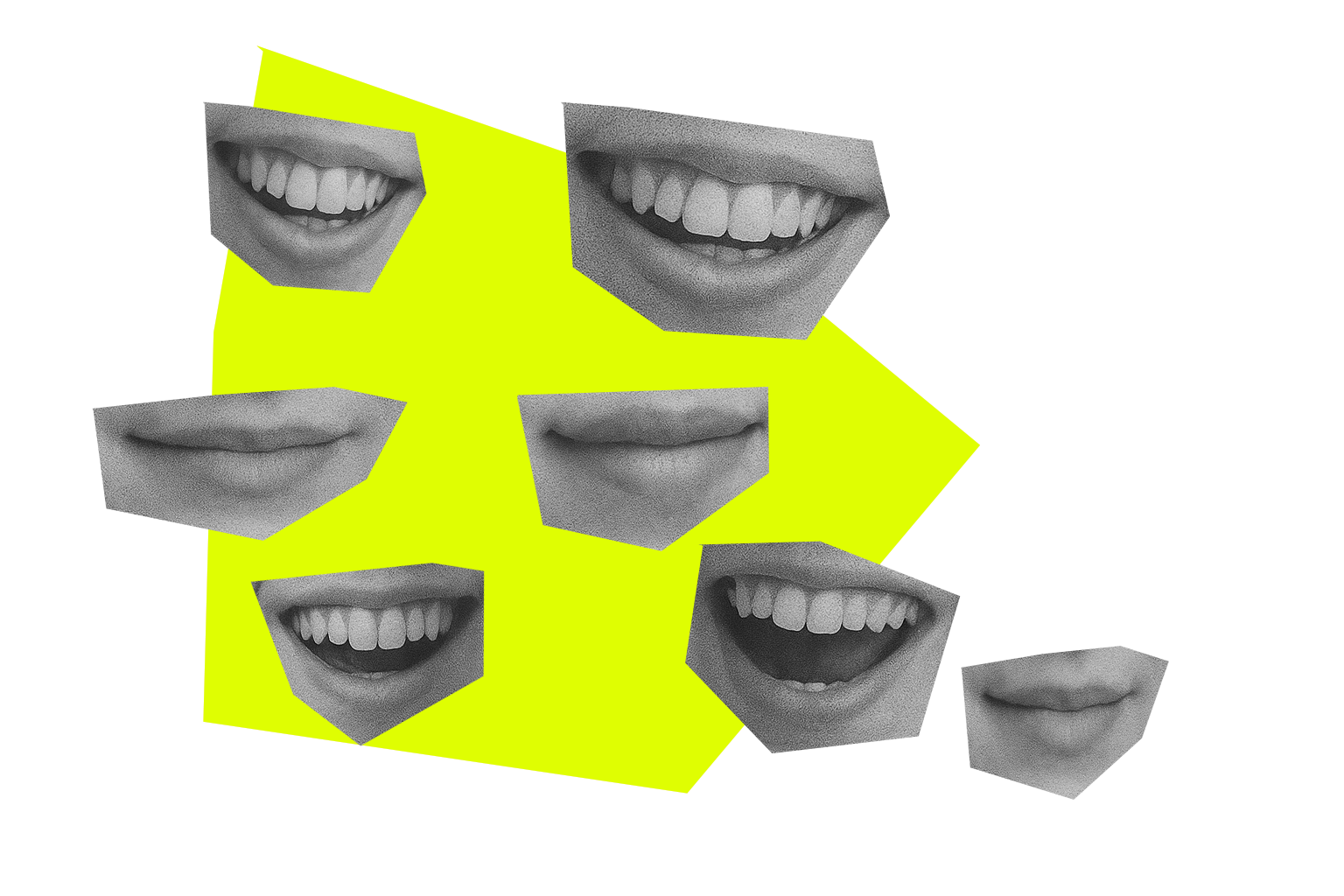
Warum Humor in Lernangeboten so wichtig ist
Vor kurzem habe ich mich mit einer Freundin über unsere Schulzeit, genauer gesagt den Französischunterricht unterhalten. Dieser ist bei mir ungefähr fünf Jahre her und ich kann mich ehrlicherweise an nicht mehr viele Vokabeln erinnern. Dennoch kam mir sofort das Wort „chapeau“, also Hut, in den Sinn. Es ist nicht so, als würde ich dieses Wort täglich benutzen. Vielmehr ist es die Situation, in der ich diese Vokabel zum ersten Mal gehört hab. Meine Lehrerin nahm einen Hut, schaute uns an, zog den Hut vom Kopf und sagte „chapeau“. Diese Situation kommt immer in mein Gedächtnis, wenn ich an meinen Französischunterricht denke und damit auch das Wort „chapeau“. Warum ist das so?
Lernen ist nicht nur ein kognitiver, sondern auch ein emotionaler Prozess. Inhalte werden nur dann wirklich aufgenommen und behalten, wenn sie mit Interesse, Motivation und positiver Stimmung verbunden sind. Nach der Instructional Humor Theory kann Humor genau hier ansetzen. Er kann Lernumgebungen angenehmer machen, Aufmerksamkeit erhöhen und eine Bindung zwischen Lehrenden und Lernenden fördern.
Was ist "Humor im Unterricht"?
Zunächst ist jedoch eine Klärung sinnvoll: Was zählt hier eigentlich als Humor im Lernkontext?
Pascal Buchmann unterscheidet zwischen geplantem und spontanem pädagogischen Humor. Geplanter Humor ist bewusst in die Lerneinheit eingebaut, spontaner Humor entsteht dagegen situativ (z.B. ein Versprecher).
Wichtig ist auch, dass Humor nicht automatisch jede humorvolle Äußerung ist, sondern dann pädagogisch wirksam, wenn er zielorientiert eingesetzt wird. Das heißt nicht nur zur Unterhaltung, sondern bewusst mit Blick auf den Lernprozess.
Außerdem zeigt sich in pädagogischen Diskussionen, dass Humor im Unterricht nicht einfach nur Witze reißen bedeutet, sondern vielmehr eine Haltung, Gestik, sprachliche Mittel oder Erzählungen umfasst, die Humor erzeugen und Lernende positiv einbinden können.
Mit diesen Begriffsvoraussetzungen im Kopf können wir zu den Gründen übergehen, warum Humor, richtig eingesetzt, so bedeutsam ist.
Warum Humor Lernen unterstützt: zentrale Wirkmechanismen
Wir können grob zwischen direkten und indirekten Lernwirkungen unterschieden, also Effekte, die über Zwischenfaktoren laufen, und solche, die direkt die kognitiven Prozesse beeinflussen.
Humor wirkt auf vielen Ebenen, die ihrerseits den Lernerfolg begünstigen. Buchmann listet sieben zentrale Aspekte, in denen pädagogischer Humor positive Effekte entfalten kann: Lernatmosphäre, Motivation, subjektive Bewertung der Lehrperson, Klassenführung, Selbstvertrauen und Gesundheit.
Ein zentraler Punkt ist Beziehung und Klima. Gemeinsam lachen stärkt das Gemeinschaftsgefühl und schafft Vertrauen. Wenn Lernende die Lehrperson als humorvoll, nahbar und sympathisch wahrnehmen, sinken Hemmschwellen und sie sind eher bereit sich aktiv einzubringen.
Auch Motivation ist zentral. Wer mit Freude lernt, zeigt mehr Ausdauer und Engagement. Humor verknüpft häufig eher langweilig wirkende Inhalte mit positiven Emotionen und steigert so die intrinsische Motivation.
Das heißt: Humor kann Lernende motivieren sich aktiv mit dem Material auseinanderzusetzen und länger dranzubleiben.
Neben den indirekten Effekten gibt es Hinweise darauf, dass Humor auch direkt auf kognitive Prozesse wirken kann.
1. Aufmerksamkeit aktivieren (Instructional Humor Theory)
Humor ist ein Überraschungsreiz. Er bricht Routinen auf und zieht die Aufmerksamkeit auf sich, In vielen Studien wird empfohlen, am Anfang eines Lernabschnitts einen humorvollen Einstieg zu wählen, um Lernende mental abzuholen.
2. Tiefere Verarbeitung und Verknüpfung
Wenn Lerninhalte mit Humor verknüpft werden, entstehen markante Assoziationen, die das Erinnern unterstützen. Durch emotionale Aufladung (Freude, Überraschung) werden Inhalte tiefer verarbeitet und im Langzeitgedächtnis verankert. Dies zeigt, wenn humorvolle Elemente thematisch eingebettet sind, können sie als kognitive Verstärker wirken.
Somit lässt sich erkennen: Humor kann nicht nur indirekt über Motivation und Atmosphäre wirken, sondern auch direkt in die kognitiven Prozesse eingreifen.
Strategien für den sinnvollen Einsatz von Humor in Lernangeboten
Damit Humor tatsächlich lerneffizient wirkt, sind einige Grundsätze und Grenzen zu beachten.
1. Dosierung und Themenbezug
Ein häufiger Fehler ist Überdosierung. Wenn zu oft oder zu unpassend gelacht wird, kann der Fokus vom Inhalt abkommen. Buchmann zitiert, dass drei bis vier humorvolle Situationen pro Unterrichtsstunde oft als Obergrenze genannt werden.
Wichtig ist, dass Humor thematisch eingebettet ist und einen klaren Bezug zum Lerninhalt hat. Wenn der Witz zu sehr vom Thema abweicht, besteht die Gefahr, dass er ablenkt.
Beispiel: In einem Sprachkurs erzählt die Lehrkraft beim Einführen neuer Vokabeln eine kurze Anekdote, die die Wörter aufgreift („Als ich das Wort umbrella zum ersten Mal brauchte, stand ich natürlich ohne Schirm im strömenden Regen …“). Das lockert die Stimmung auf, ohne vom Lernziel abzulenken.
2. Zielgruppen und Humorverständnis
Humor ist kulturell geprägt und hängt vom Alter, Vorerfahrungen und Humorpräferenzen der Lernenden ab. Ein Witz, den Erwachsene lustig finden, kann von Kindern eventuell gar nicht verstanden werden. Diese Schwierigkeit tritt vor allem auch bei Ironie und Sarkasmus auf.
Deshalb muss im Vorfeld analysiert werden: Was gefällt, was wird verstanden, was wirkt verletzend? Ein sensibler Umgang ist entscheidend.
Beispiel: In einer Schulung für Auszubildende verwendet die lehrende Person kleine Memes aus aktuellen Social-Media-Trends, die die Jugendlichen sofort erkennen und witzig finden. Derselbe Humor würde in einer Weiterbildung für Führungskräfte wahrscheinlich gar nicht zünden – dort funktionieren eher kurze Alltagsanekdoten aus dem Büro- oder Projektkontext.
3. Authentizität und Teilhabe
Humor wirkt am besten, wenn er echt wirkt, also nicht erzwungen oder gekünstelt. Lehrende sollten keinen „Clown“ spielen, sondern Elemente einbringen, die zur eigenen Persönlichkeit passen. Auch partizipative Humorformen können wirksam sein. Lernende einzubeziehen, zum Beispiel durch witzige Aufgaben, Wortspiele oder kleine Sketches, kann das Engagement zusätzlich fördern.
Beispiel: In einem Workshop schreiben die Teilnehmenden selbst kurze „falsche Schlagzeilen“ zum Thema, die humorvoll, aber inhaltlich korrekt auf das Lernziel verweisen.
4. Timing und Sensibilität
Der Zeitpunkt ist entscheidend: In Konzentrationsphasen oder Prüfungen kann zu viel Humor stören. Der Einsatz sollte gut dosiert sein und mit Rücksicht auf die aktuelle Stimmung und Bedürfnisse der Lernenden erfolgen.
Außerdem darf Humor nicht verletzend, bloßstellend oder ausgrenzend sein. Wenn sich jemand gedemütigt fühlt, ist die Wirkung komplett gegenteilig zur Intention.
Beispiel: Während einer intensiven Schreibübung bringt die Lehrkraft keinen Witz, sondern erst nach der konzentrierten Phase eine kleine humorvolle Auflockerung.
Fazit
Ob ein chapeau im Französischunterricht, eine witzige Anekdote in einer Schulung oder ein spontaner Versprecher, Humor schafft Momente, die im Gedächtnis bleiben. Er verbindet Emotionen mit Inhalt, stärkt Beziehungen und kann selbst komplexe Themen leichter zugänglich machen. Entscheidend ist dabei nicht der laute Lacher, sondern die positive Atmosphäre, die entsteht.
Wer Lernangebote mit Humor anreichert, schafft mehr als Unterhaltung. Er schafft Räume für Motivation, Aufmerksamkeit und nachhaltiges Erinnern.

Noch mehr Impulse für lebendige Lernräume?
Abonniere unseren Hallo Lerngestalter:in Newsletter – und erhalte unser digitales Learning Architects Playbook gratis dazu.
Beitragsbild: Illustration erstellt mit Unterstützung von KI (ChatGPT, OpenAI)