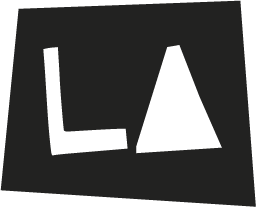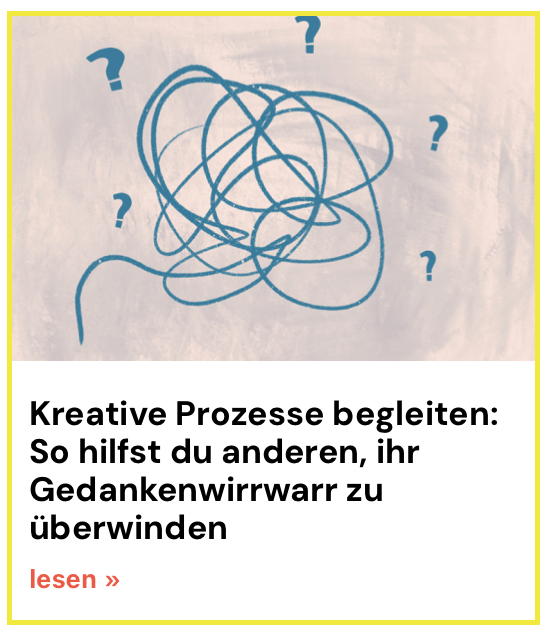Zukunftskompetenz: 5 Praxisideen mit Spekulativem Design
Erst kürzlich habe ich das Video Egg on Rice von Pei-Ying Lin gesehen: Eine Frau sitzt vor einem Teller Reis mit Ei und isst angeblich Viren. Ich war fasziniert, verwirrt und leicht abgestoßen. Genau diese Irritation hat mich nicht mehr losgelassen.
Solche Denkanstöße sind typisch für spekulatives Design. Es geht nicht darum, Zukunft vorherzusagen, sondern sie greifbar und diskutierbar zu machen. Und genau darin liegt ein riesiges Potenzial für Bildung.
In unserer aktuellen Podcast-Folge spreche ich mit Katrina Günther (Kitty) von futuresphrobes darüber, wie spekulatives Design in der Bildung angewendet werden kann. Hier im Beitrag zeige ich dir, warum dieser Ansatz mehr als eine Kreativmethode ist und wie du ihn konkret in Lernsettings einsetzen kannst, um Zukunftskompetenz zu fördern.
Was ist Spekulatives Design?
Spekulatives Design ist ein innovativer Designansatz, der mit möglichen (und oft unwahrscheinlichen) Zukunftsszenarien arbeitet. Ziel ist nicht das Finden von Lösungen, sondern das Infragestellen bestehender Annahmen. Es stellt Fragen wie: Was wäre, wenn…? und eröffnet dadurch neue Denk- und Diskussionsräume. Lernende reflektieren ethische, technologische und gesellschaftliche Entwicklungen und trainieren gleichzeitig wichtige Future Skills wie kritisches Denken, Kreativität und systemisches Verstehen.
Ein für mich besonders inspirierendes Beispiel ist das schon oben angedeutete Projekt Virophilia von Pei-Ying Lin. Das künstlerisch-kulturelle Forschungsprojekt untersucht, wie wir unsere Beziehung zu Viren neu denken können – nicht als bloße Krankheitserreger, sondern als Teil unserer biologischen Evolution. Es kombiniert ein futuristisches Kochbuch, Installationen, Videoarbeiten und Dinner-Performances zu einer multisensorischen Lernerfahrung.
Warum Spekulatives Design?
Unsere Welt ist komplex, vernetzt und dynamisch. Um sich darin orientieren und sie mitgestalten zu können, brauchen Lernende mehr als Fachwissen. Sie brauchen Zukunftskompetenzen: die Fähigkeit, Ungewissheit auszuhalten, neue Fragen zu stellen und gemeinsam kreative Wege zu finden. Genau hier setzt spekulatives Design an. Es schafft Lernräume, in denen Vorstellungskraft, Reflexion und Handlungskompetenz gefördert werden.
Damit spekulatives Design nicht nur ein spannendes Konzept bleibt, sondern wirklich Wirkung entfalten kann, braucht es bestimmte Methoden und partizipative Zugänge. Im Zentrum steht dabei die Entwicklung von Prototypen als Diskussionsobjekte – sogenannte Artefakte, die durch ihre Gestaltung provokative Fragen aufwerfen und zum Nachdenken anregen. In Co-Speculation Sessions oder ähnlichen Workshop-Formaten entwickeln Teilnehmende gemeinsam mögliche Zukünfte, unterstützt durch visuelle und narrative Techniken wie Kurzgeschichten, Comics, Rollenspiele oder Videos. Ziel ist es, möglichst greifbare, erfahrbare Zukunftswelten zu schaffen und dabei vielfältige Perspektiven einzubeziehen.
Wie das in der Praxis aussehen kann? Hier sind fünf Ideen:
1. Zukunftsszenarien entwickeln
Lernende formulieren eigene „Was wäre, wenn…?“-Fragen und entwickeln daraus Zukunftsszenarien. Zum Beispiel: Was passiert, wenn Wasser ein privatisiertes Luxusgut wird? Oder wenn Schulnoten durch KI-gesteuerte Kompetenzprofile ersetzt werden? Die Lernenden entwerfen kleine Zukunftserzählungen, Comics, Podcasts oder Kurzfilme.
Eine gute Zukunftserzählung, so beschriebt es Katrina Günther auch im Gespräch, öffnet Vorstellungsräume, sie zeigt nicht „die Zukunft“, sondern eine mögliche Zukunft, die zum Denken und Diskutieren anregt. Sie dockt dabei an gegenwärtige Entwicklungen an, etwa an technologische Trends, gesellschaftliche Fragen oder kulturelle Muster, und ermöglicht so einen Perspektivwechsel auf das Hier und Jetzt. Dabei lernen die Teilnehmenden, systemisch zu denken, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und gesellschaftliche Konsequenzen zu reflektieren.
2. Fächer- und Themengrenzen überwinden
Statt Inhalte isoliert zu behandeln, kombinieren Lernende verschiedene Disziplinen. Eine Aufgabe könnte lauten: „Entwerft ein Produkt für den Alltag in einer Welt, in der Menschen nicht mehr schlafen müssen.“ Dazu braucht es biologische Grundlagen, Design-Know-how, ethische Reflexion und wirtschaftliches Denken. Lehrende arbeiten im Team, Lernende in interdisziplinären Gruppen. So entstehen Querverbindungen, die echtes Transferdenken ermöglichen.
3. Sinne ansprechen
Lernen über Geschmack, Geruch, Klang oder Bewegung macht Zukunftsszenarien erfahrbar. Diese multisensorischen Zugänge verstärken nicht nur das Verstehen, sondern machen komplexe Inhalte emotional zugänglich. Ein eindrückliches Beispiel ist für mich das oben genannte Projekt Virophilia von Pei-Ying Lin. Besonders ihr Video Egg on Rice hat mich beschäftigt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt: Isst sie da jetzt wirklich Viren? Solche Irritationen wirken nach und machen Lernen sinnlich erfahrbar.
4. Rollen wechseln
Lernende schüpfen in andere Identitäten: Zukunftsforscher:innen, Politiker:innen, Start-up-Gründer:innen, Roboter mit Gefühlen oder Aliens mit Blick auf unsere Gesellschaft. In Debatten, Simulationen oder fiktiven UN-Konferenzen vertreten sie verschiedene Interessen und entwerfen Lösungen für Zukunftsfragen. Dieses Rollenspiel fördert Empathie, Ausdrucksfähigkeit und komplexes Denken.
5. Diskussionen inszenieren
Kontroverse Themen brauchen einen geschützten Raum für Austausch. Spekulatives Design kann diesen schaffen, indem es die Diskussion ins Abstrakte oder Zukünftige verschiebt: Statt über reale und sehr wahrscheinliche Klimaschutzmaßnahmen zu streiten, könnten sich Lernende mit einer Gesellschaft beschäftigen, in der jede Person ein persönliches CO2-Limit pro Jahr zugeteilt bekommt. So wird Reflexion möglich, ohne dass „echte“ Positionen sofort bewertet werden müssen.
Fazit: Lernen für die Zukunft
Spekulatives Design macht Zukunftskompetenz erfahrbar. Besonders spannend ist es, wenn Lernende nicht nur über Zukunft nachdenken, sondern sie aktiv gestalten. Genau daran arbeiten wir auch bei Learning Architects: mit Lernformaten, die neue Fragen stellen, Perspektiven verschieben und echtes Mitgestalten ermöglichen.
Welche „Was wäre, wenn…?“-Frage willst du als nächstes stellen?

Noch mehr Impulse für lebendige Lernräume?
Abonniere unseren Hallo Lerngestalter:in Newsletter – und erhalte unser digitales Learning Architects Playbook gratis dazu.
Beitragsbild: Illustration erstellt mit Unterstützung von KI (ChatGPT, OpenAI)