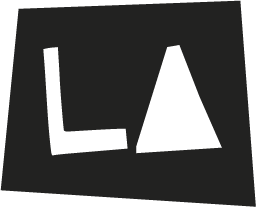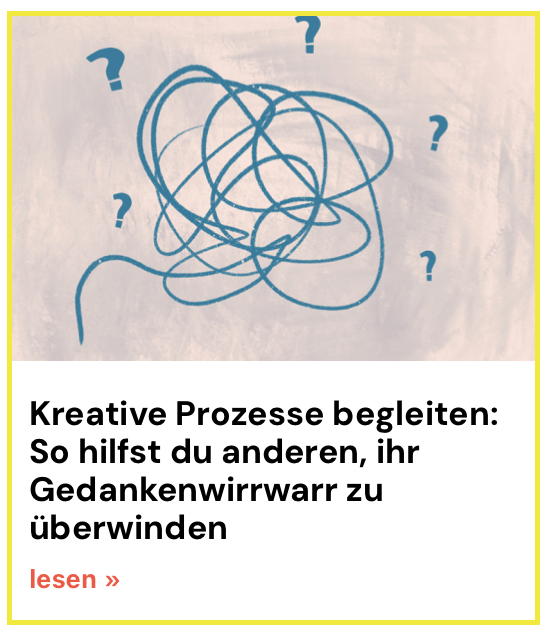Spiele aktiv im Lernprozess erarbeiten – in 5 Schritten zum Spiel im Angebot
Spiele in Lerneinheiten, sei es ein Mathe-Quiz, ein Brettspiel oder ein Bewegungsspiel, kennen die meisten vor allem aus Vertretungsstunden oder den letzten noch zu füllenden Minuten eines Workshops. Für viele Lehrende und Lernende gehören sie eher in die Kategorie „Zeitvertreib“ als in den normalen Lernprozess.
Diese Haltung führt dazu, dass Spiele häufig als nette Abwechslung eingesetzt werden, ohne klare Verbindung zu Lernzielen. Dabei steckt in ihnen weit mehr.
In der Artikelserie „Spielpädagogik – das freie Spiel und seine Bedeutung für die Entwicklung des Kindes von 0-6 Jahren“ heißt es:
„Spielen IST Ideen entwickeln, etwas ausprobieren, verwerfen, neu beginnen. Spielen IST Lösungen finden, andere Perspektiven einnehmen, Erfahrungen sammeln, Rollen und Regeln aushandeln.“
Wenn angehende Erzieher:innen gefragt werden, was Kinder beim Spielen eigentlich lernen, sprudeln die Antworten nur so heraus:
- den Umgang miteinander und das Einhalten von Regeln
- sprachliche Fähigkeiten (vor allem bei Kindern, die Deutsch als Zweitsprache lernen)
- Kreativität, Konzentration und Ausdauer
- Frustrationstoleranz, Mut und Selbstvertrauen
- Teamarbeit, Konfliktlösung und Perspektivwechsel
Auch Kilian (2022) kommt in der Fachzeitschrift Wissensmanagement zu dem Schluss: Spiele sind ein wichtiger Baustein im Lernprozess.
Warum Spiele im Lernprozess wichtig sind
Spielen ist ein zutiefst menschlicher Weg zu Lernen. Kinder und Erwachsene lernen fast automatisch, wenn sie spielerisch tätig sind. Dieses Prinzip ist längst auch in Neuropsychologie und Pädagogik als universeller Lernmechanismus anerkannt.
Spiele verknüpfen Lernen mit Motivation, ermöglichen soziale Erlebnisse und fördern zentrale Kompetenzen, wie Problemlösefähigkeit. Auch komplexe Inhalte lassen sich spielerisch vermitteln und verankern. Zudem stärken Spiele Sozialkompetenzen, wie Frustrationstoleranz, Kommunikation, Teamfähigkeit und Empathie.
Wie sich Spiele mit Lernenden im Unterricht, in Workshops oder anderen Lernumgebungen entwickeln lassen, erklären wir dir im nächsten Abschnitt.
Schritt-für-Schritt zum Spiel
1. Lernziel und Thema erklären
Definiere zunächst das Lernziel (z.B. Wortschatz, Burchrechnung etc.) und das Thema. Ein klarer Fokus erleichtert die Spielentwicklung.
Beispiel 1: Ein Lernziel im schulischen Kontext könnte das Kennenlernen von Umlauten sein.
Beispiel 2: Ein weites Beispiel wäre ein Workshop, in dem Lernende sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Dabei besteht das Lernziel darin, den Lernenden wichtige Aspekte der Nachhaltigkeit, wie Ressourcenschonung, näherzubringen.
2. Funktion und Format wählen
Entscheide, ob das Spiel eher kooperativ oder kompetitiv sein soll, gruppenorientiert oder individuell, analog oder digital. Im Vorhinein kannst du dir als Lerngestalter:in Gedanken machen: Welches Format könnte am besten passen? Was habe ich für Materialen (Nicht immer muss etwas Neues gekauft werden. Schaue welche Materialien du Zuhause hast oder lasse auch die Lernenden etwas von Zuhause mitbringen). Es muss auch nicht immer ein komplett neues Spiel entstehen, du kannst dich auch einfach an bekannten Spielen orientieren.
Beispiel 1: Zum Lernziel Umlaute könnte ein analoges Bildpaarspiel erstellt werden. Dazu würde dickes Papier, Scheren und Stifte als Material genügen. Nun könnten die Lernenden selbst Karten erstellen. Auf eine Karte würde ein Wort mit Umlaut geschrieben werden und auf die dazugehörige ein Bild des Begriffes. Alterativ können die Lernenden vorab Zuhause schon nach Wörtern mit Umlauten schauen und jeweils 5 Kartenpaare vorbereiten.
Beispiel 2: Für das Thema Nachhaltigkeit könnte ein kompetitives Quizspiel erstellt werden. Die Gruppe wird dafür in Kleingruppen aufgeteilt und kann gemeinsam Punkte sammeln. Im Vorfeld müssen dafür Spielkarten mit Fragen und Aufgaben entwickelt werden. Auch hier reicht es, die Fragen auf dickes Papier zu schreiben.
3. Spiel skizzieren
Entwirf Spielregeln, Aufgaben, Abläufe und einen Zeitrahmen. Auf Seiten wie Methodenpool oder Ideenwolke findest du Anregungen.
Beispiel 1: Für das Umlaute-Paarspiel kann man sich an den klassischen Memoryregeln orientieren. Lernende decken der Reihe nach zwei Karten auf. Wer den passenden Begriff zum Bild findet, darf das Kartenpaar behalten. Um das Lernziel noch stärker im Blick zu behalten, können die Memoryregeln weiter angepasst werden. So wäre es denkbar, dass die Lernenden zu jedem Kartenpaar die Umlaute des Wortes benennen sollen. Zeitlich kann das Spiel beispielsweise auf fünf bis zehn Minuten oder maximal zwei Wiederholungen begrenzt werden.
Beispiel 2: Im Workshop zum Thema Nachhaltigkeit können die Teams abwechselnd entscheiden, ob sie eine Fragenkarte oder eine Aufgabenkarte nehmen möchten. Diese muss dann beantwortet werden. Das Team mit den meisten beantworteten Karten gewinnt. Beispiel-Frage: „Was spart am meisten CO₂ ein?“ (Antwort A, B oder C); Beispiel-Aufgabe: „Zählt in 30 Sekunden 5 Möglichkeiten auf, Wasser zu sparen.“
4. Spiel erstellen und Prototypen testen
Beginne das Spiel konkret zu erstellen (Müssen Spielkarten erstellt werden? Was muss sonst noch vorbereitet werden?). Auch hier können die Lernenden in den Prozess integriert werden. Wenn ein erster Prototyp des Spiels erstellt ist, kann das Spiel ausprobiert werden. Reflektiert danach, was hat gut funktioniert und was muss eventuell noch angepasst werden?
Beispiel 1: Zur Erstellung des Umlaute-Paarspiels ist es zunächst notwendig das genügend Kartenpaare vorhanden sind. Nun kann das Spiel in Kleingruppen oder in der großen Gruppe getestet werden. Im Anschluss ist das Feedback der Lernenden wichtig. Sind alle Wörter verständlich? Ist der Ablauf klar geregelt?
Beispiel 2: Für den Nachhaltigkeitsworkshop kann zunächst nur ein kleiner Teil der Karten genutzt werden. Dabei sollte geschaut werden, sind die Art der Fragen und Aufgaben verständlich? Sind sie mit dem Wissen aus dem Workshop lösbar?
5. Implementierung im Lernprozess
Führe das fertige Spiel ein. Achte auf eine klare Anleitung, eine kurze Demonstration und Raum für Fragen. Im Anschluss an das Spiel ist es wichtig, dieses noch einmal in den Gesamtkontext der Lerneinheit einzubetten.
Beispiel 1: Für das Umlaute-Paarspiel heißt das, dass das Spiel nach einer Überarbeitung (z.B.: unverständliche Begriffe wurden aussortiert) im Unterricht eingeführt wird. Im Anschluss kann noch einmal reflektiert werden, was für Umlaute gelernt wurden.
Beispiel 2: Im Workshop bedeutet das, dass das Spiel noch einmal für alle erklärt wird. Dann wird eine moderierende Person, die die Antworten der Fragen und Aufgaben hat, festgelegt. Wenn Kleingruppen gebildet sind, kann das Spiel gespielt werden. Im Weiteren sollte reflektiert werden: Was war für dich der größte „Aha-Moment“ im Spiel? Welche Karten oder Aufgaben haben besonders viel Diskussion ausgelöst – und warum?
Fazit
Spiele sind mehr als bloßer Spaß. Sie bieten kraftvolle methodische Ansätze. Wer Lernende in die Gestaltung eigener Spiele mit einbezieht, fördert Motivation, Reflexion und Problemlösekompetenzen ganz nebenbei. Mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung und einem Blick auf die Praxis bist du bestens gerüstet, das spielerische Lernen gemeinsam mit Lernenden zu entwickeln.
Wenn du Lust hast, noch mehr ins Thema einzusteigen: In unserer aktuellen Podcastfolge geht es darum, wie du spielerische Elemente in Ideen- und Kreativphasen bewusst einsetzen kannst.
Viel Freude beim Ausprobieren!

Noch mehr Impulse für lebendige Lernräume?
Abonniere unseren Hallo Lerngestalter:in Newsletter – und erhalte unser digitales Learning Architects Playbook gratis dazu.
Beitragsbild: Illustration erstellt mit Unterstützung von KI (ChatGPT, OpenAI)